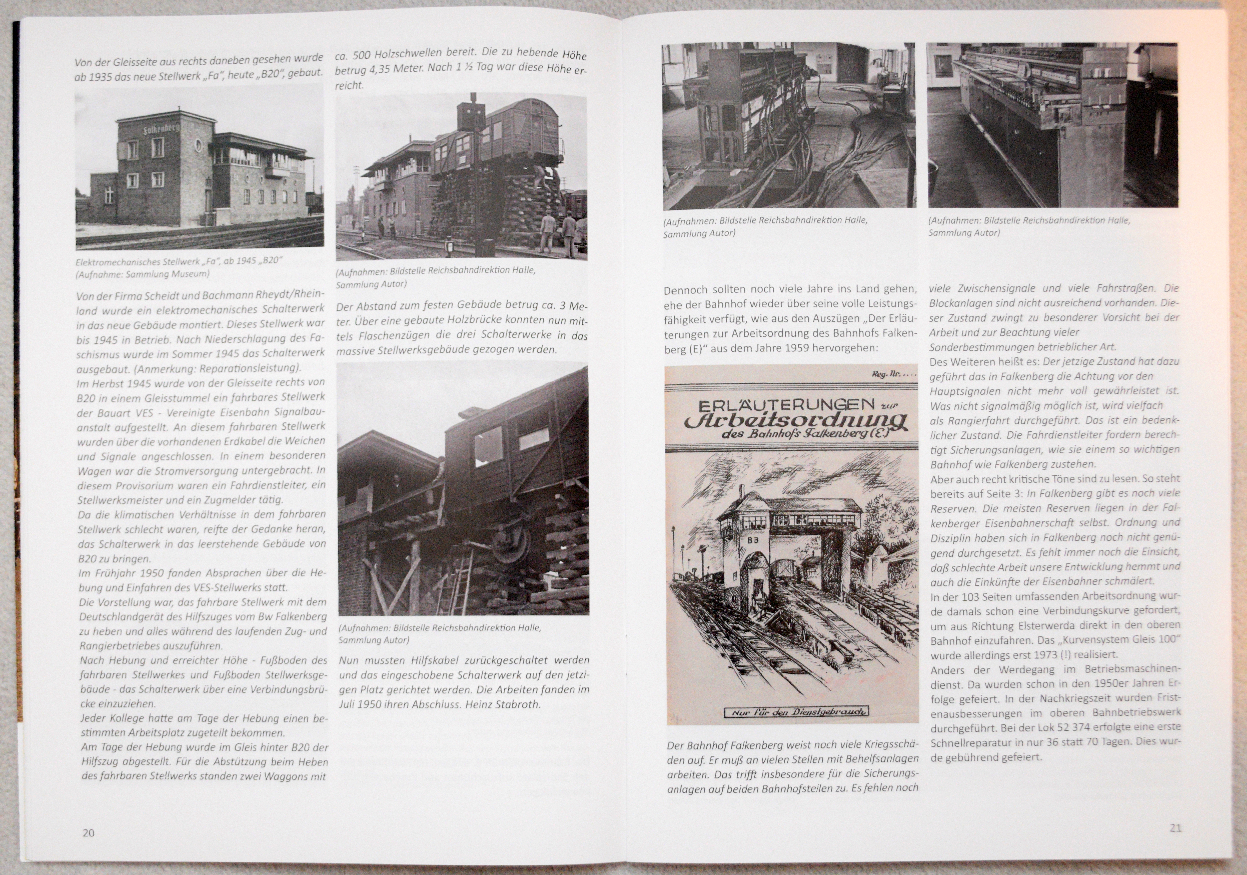Das fröhliches Völkchen von Frankenhain im Schliebener Becken
Eigentlich galt der Streifzug einem ganz anderem Thema als Zampern. Doch bei diesem fröhlichen Völkchen konnte die Foto-Linse nicht widerstehen.
Tradition auch in Frankenhain, zampernd geht es von Haus zu Haus.
Ein bunter Trupp zog durch Frankenhain. Mit ordentlicher Musik und ausgestattet mit allerlei Stimmungs-Masse, ging es durch den Ort im Schliebener Becken.
Zampern in Frankenhain (Schliebener Becken)
Spontan wurde ein Gruppen-Fotoshooting vereinbart. Was natürlich prompt gelang. Und auch die Sonne spielte mit, was zu einigen farbenfrohen Fotos führte.
 |
| Foto-Shooting mit kleinem Konfetti-Regen. |
Wie üblich bei 8 Megapixel, wurde vereinbart die Fotos dem Verein zur Verfügung zu stellen.
Das alte Reihen-Siedlerdorf aus dem 14. Jahrhundert, verfügt über einige bemerkenswerte Gebäude, die auch die Kriegswirren überstanden haben. Hier zwei davon.
Im Zentrum des Ortes, der heute kein Reihendorf mehr ist, befindet sich ein historischer Glocken- und Feuerwehrturm. Eine eher seltene Kombination. Schon vom Höhenzug der Dürichener Heide aus, ist er gut erkennbar. Leider ist der Gebäudefuß des Fachwerkbaus beschädigt. Wie lange er noch so stehen darf ist offen.
 |
Historischer Glockenturm und Feuerwehrturm in Einem. Selten.
Davor ein kleiner sehr gepflegter Park mit Denkmal und Sitzgelegenheit. |
Einige Meter weiter westlich befindet sich ein Haus aus dem Jahre 1848. Gebaut mal als Vierseitenhof. Später offenbar mal ein Gasthaus.
|
| Historisches Haus mit Bogenfenstern aus dem Jahr 1848. |
 |
| Mit schöner historischer Holztür. |
 |
| Und nettem Detail, die Jahreszahl 1848. |
Geologisches Detail
Auch geologisch ist der Ort bemerkenswert. An seiner Südostseite endet ein uralter Elbeverlauf aus der Holstein-Warmzeit. Am Ende des Elsterglazials vor etwa 320 000 Jahren, arbeitete sich der Senftenberger Elbe-Verlauf nach Nordwesten vor und hinterließ einen vier bis sechs Kilometer breiten Kieszug. Dieser endete in Frankenhain. Markanter Endpunkt ist eine ehemalige Kiesgrube am Südostende des Dorfes.
 |
Ehemalige Kiesgrube in Frankenhain. Heute Badeteich
und Kulturzentrum mit Freilichtbühne. |
Der bekannt deutsche Geologe Kurt Genieser, hat das 1962 im Rahmen seiner Forschungen zu den Elbe-Verläufen ermittelt.
Vielen Dank an die Zamperer für die freundliche Aufnahme und die Gelegenheit spontan mehr über das Dorf im Schliebener Becken zu erfahren.
Und weiter geht es mit dem Zampern. Viel Spaß noch.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quellen:
Neue Daten zur Flußgeschichte der Elbe
Zielsetzung und Ergebnisse von Kartierungsbohrungen und -schürfen im Pleistozän
des Raumes zwischen Dresden und Berlin
Von KURT GENIESER, Hannover 1962
Funde südlichen Gerölls in Südbrandenburg und Ostsachsen von der Neiße bis zum nördlichen sächsischen Elbtal von Dr. Dieter Schwarz, Cottbus, Deutschland 2012