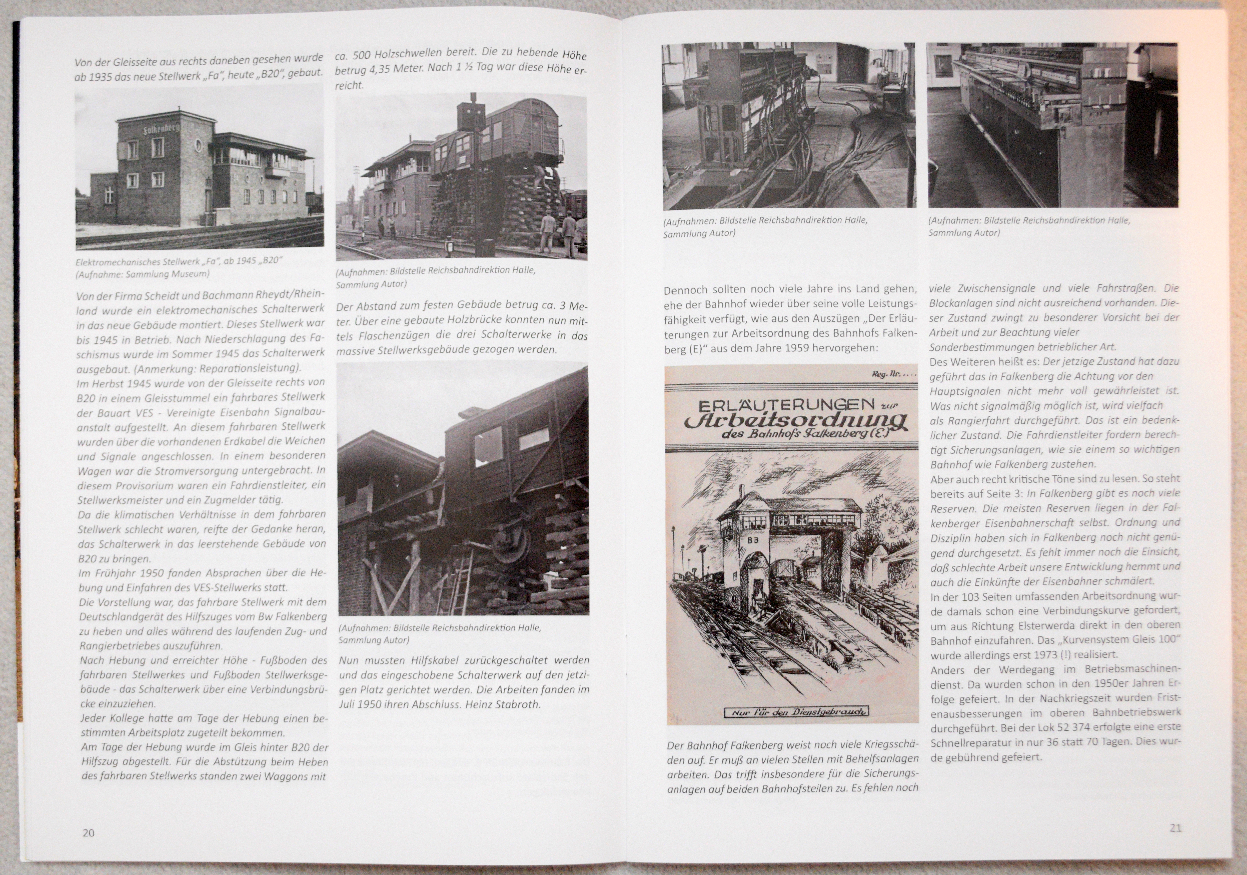Ultramylonit von Ponnsdorf /Niederlausitz und Mylonitfunde von Kemmen und Calau
Beim Aufräumen des Kellers fällt ein fast vergessenes Fundstück in die Hände. Ein Gestein mit einer bunten, merkwürdigen faltenreichen Relief-Oberfläche.
Foto 1: Ultramylonit von Ponnsdorf /Niederlausitz
(Landkreis Elbe Elster).
Und dann bringt es die Erinnerung wieder ans Licht.Freundliche Frauen eines Landwirtschaftsbetriebes der Gegend, laden den Beifang einer Kartoffelerntemaschine ab. Neben einem recht großen Brocken skandinavischer Agglomeratlava, auch ein zu kleinen Falten verformtes sehr hartes farbiges Gestein. Ultramylonit, wie sich erst Jahre später herausstellen sollte.
Viele Jahre danach, gesellten sich beim Stöbern in den Erosionsrinnen bei Kemmen und der Herrenheide nahe Calau, zwei weitere schöne Fundstücke dazu.

Foto 2: Mylonit der Herrenheide bei Calau (Landkreis OSL).
 |
| Karte: Fundorte der Mylonite in der Niederlausitz. |
Was sind Mylonite und wie entstehen sie?
Es handelt sich um tektonische Verformungsgesteine, wie es der Geologe Peter Heitzmann einmal formulierte. Gesteine, die sich in großer Tiefe, unter enormen Druck und hohen Temperaturen verformen, ohne dabei zu zerbrechen oder zu reißen.
Solche Gesteine entstehen wenn sich tektonische Platten in größerer Tiefe aneinander vorbei schieben, duktile Scherzonen genannt. Das können Subduktionszonen sein. Zonen der Erdkruste, bei denen sich tektonische Platten untereinander schieben. Noch heute finden weltweit solche Prozesse statt. Beispielsweise an Kontinentalrändern, wie dem Pazifischen Feuerring oder im Mittelmeer, wo sich Teile der Afrikanischen unter die Europäische Platte schieben.
Aber auch wenn sich zwei tektonische Platten aneinander vorbei schieben. Seitenverschiebung. Dafür gibt es in Mitteleuropa zahlreiche Beispiele, selbst in der Niederlausitz. Der Lausitzer Hauptabbruch ist in unserer unmittelbaren Umgebung so eine Störungszone. Wer mehr darüber wissen möchte findet hier weitere Informationen: Was sind Scherzonen?
Eine weitere Möglichkeit, wenn Magma aus großen Tiefen aufsteigt und sich in der Erdkruste Platz verschafft, ohne das es die Oberfläche durchbricht und ein Vulkan ausbricht. Mit dem 540 Millionen Jahre alten Lausitzer Granodiorit-Komplex, gibt es vor unserer Haustür so ein Beispiel.
Gesteine, die dabei erheblich verändert werden, ordnen Geologen den Regionalmetamorphen Gesteinen zu. Mehr dazu hier bei Wikipedia. Siehe: Metamorphes Gestein
Unser Ultramylonit von Ponnsdorf ist also ein Regionalmetamorphes Gestein mit einem sehr deutlichen Verformungsgefüge und gehört damit zur Gruppe der Mylonite. Bei Myloniten oder mylonitischen Gesteinen, muss man eher von einem Gefüge und einem Verformungsprozess sprechen, weniger von einem Gestein oder Gruppe von Gesteinen. Hintergrund ist: Ein Verformungsgefüge (Mylonitisierung) kann sich in fast jedem Gestein entwickeln. Es ist immer abhängig von der Zusammensetzung des Ausgangsgesteins sowie den Druck- und Temperaturverhältnissen in duktilen Scherzonen. Entsprechend vielfältig sind diese Gesteine.
Gemeinsam haben sie ihr ausgewalztes bis fließendes Gefüge. Denn wie oben bereits angedeutet, wird eine Gesteinsmasse den Bedingungen von extremen gerichtetem Druck und hohen Temperaturen ausgesetzt, kommt es nicht mehr zum Bruch sondern zur plastischen Verformung der Minerale, dem Auswalzen, bis hin zu Fließstrukturen. Dabei handelt es sich nicht um eine simples Plattwalzen der Minerale sondern um einen dynamischen Umkristallisationsprozess in den Mineralen, in die tektonische Druckrichtung. Geologen nennen diesen Prozess Versetzungskriechen.
 |
| Foto 3: Augenmylonit (Augengneis) von Kemmen bei Calau |
Augenmylonite sind eine erste Form davon. Sie werden auch häufig Augengneise genannt. Doch Augengneise können auch durch andere geologische Prozesse entstehen.
In einem Fundstück von Kemmen (oben) ist das Auswalzen bereits sehr gut zu erkennen. In der Mitte sind neugebildeten fleischfarbenen Kalifeldspatkristalle augenförmig verformt. Größere Kristalle wurden zum Teil in Druckrichtung wieder zerbrochen. Sie werden von dunklem Biotit und dunkelgrauem Quarz regelrecht umflossen. Das Umfließen ist ein typisches Merkmal der Mylonitisierung. Unser Fundstück zeigt, die großen fleischfarbenen Kalifeldspatkristalle entstanden bereits bevor der Prozess der Mylonitisierung einsetzte. Diese Art der Kristalle werden im Fachjargon auch Porphyroklasten genannt.
Mit dem Zerbrechen der Kristalle, ergibt sich ein wichtiger Hinweis auf die Druckverhältnisse. Da die Festigkeit der Minerale gut bekannt ist, wird eine zeitliche Abfolge für die Wissenschaftler erkennbar.
Im Foto des Augenmylonits oben, haben sich die Zwischenräume der gebrochenen Kalifeldspatkristalle mit einer weißen mikroskopischen Mineralmasse ausgefüllt. Wir können hier von fein zermahlenem milchigem Quarz und feinsten Plagioklas ausgehen. Mehr als 50 Prozent der enthaltenen Minerale sind in die Mylonitisierung einbezogen aber noch nicht alle. Ein sogenanntes Protomylonit ist damit entstanden. Die erste Form der Mylonitisierung.
 |
| Foto 4: Detailaufnahme Augenmylonit von Kemmen mit feinster Kristallmenge. |
 |
| Foto 5: Detailaufnahme der Unterseite des Augenmylonit von Kemmen. |
Nein es handelt sich auf dem Foto hier nicht um Gammelfleisch, auch wenn es vielleicht so aussieht. Es sind buchstäblich platt kristallisierte Kalifeldspatkristalle. Auf der linken Seite ist ein einzelner ebenfalls plattgedrückter Plagioklaskristall zu erkennen. In den Zwischenräumen befindet sich die fein zerdrückte Masse aus Quarz (grau), Plagioklas (weiß) und etwas Biotit (schwarz).
Mit zunehmender Tiefe, dem Anstieg der Temperaturen und des Drucks, wird die Gesteinsmasse plastischer, verformbarer. Vorhandene Minerale werden aufgrund der Bewegung kleiner. Das führt bis zum streckenweisen Verlust der Mineralstrukturen. Stattdessen entsteht eine zerflossene feinschichtige oder flächenhafte fasrige Matrix, wie die Geologen sagen.
 |
| Foto 6: Mylonit aus der Herrenheide bei Calau. |
An dem Fundstück aus der Herrenheide bei Calau, ist der Fortschritt der Mylonitisierung gut zu erkennen. Durch den gewachsenen gerichteten Druck, ist eine deutliche Schrumpfung der Minerale erkennbar. Ein wichtiges Charakteristikum von Myloniten. Die Gesteinsmasse ist hier fein zerfasert, fast mikroskopisch und gut ausgewalzt. Nur einzelne Plagioklas-Kristalle (weiß), als Porphyroklasten bezeichnet, widersetzen sich noch dem hohen Druck. Oben Links hat es ein Quarz (schmutzig grau) geschafft sich doch noch mal Platz zu verschaffen. Ein Meso-Mylonit ist entstanden.
Interessant an dem Fundstück aus der Herrenheide bei Calau, ist oben rechts ein Verwitterungshorizont.
 |
| Foto 7: Verwitterungshorizont |
Diese scheinbare Grenze zeigt einen wichtigen Punkt. Die Mylonitisierung eines Gesteines wird oft erst durch Verwitterung der Oberfläche richtig sichtbar. Am frischen Bruch oder bei noch nicht ausreichender der Verwitterung, weil der das Gestein schlicht im Boden lag, ist die Mylonitisierung auf den ersten Blick nur schlecht erkennbar. Doch auch hier gibt es Ausnahmen, die zu wesentlichen Teilen von der Zusammensetzung des Ausgangsgesteins abhängen.
Doch es gibt einen Kniff: Einfach das Gestein mit einer Sprühflasche nass machen. Dann tritt dessen Struktur optisch besser hervor.
Ein weiteres interessantes Detail am Fundstück bei Calau ist die Bildung von Muskovit (hell glänzend), anstatt von Biotit (schwarz).
 |
Foto 8: Mylonit aus der Herrenheide, Calau. Die Unterseite mit
neugebildetem Muskovit (Hellglimmer). |
Dieses Mineral entsteht typischerweise in sauren Gesteinen wie Gneis, Schiefer, Pegmatit, Granit und gibt damit Anhaltspunkte auf seine möglichen Ursprungsgesteine.
Auf einem Vergleichs-Fundstück von der Küste der Insel Rügen (Foto unten), ist der gesamte Prozess der Mylonitisierung von oben nach unten sehr gut zu verfolgen. Oben sind noch Reste des Protomylonits zu erkennen. In der Mitte ist die Kristallstruktur komplett dem riesigen Druck und hohen Temperaturen zum Opfer gefallen. Erkennbar an der feinen flammigen Laminierung. Nach unten hin nimmt die größere Kristalle wieder etwas zu. Wir blicken hier also in das Zentrum einer geologischen Scherzone.
 |
| Foto 9: Ostsee-Fundstück. Ultramylonit von der Insel Rügen. |
Abhängig vom Ursprungsgestein, setzen solche Prozesse der Mylonitisierung ab Tiefen von über 4 Kilometern ein. Ab diesen Tiefen werden die nötigen Druckverhältnisse erreicht, die eine Verformung der Mineralkörner von Kalk- und Salzgesteinen ermöglichen. Mit der weiter steigenden tektonischer Beanspruchung, zunehmender Tiefe und Erhöhung der Temperaturen, kommt es zur Neubildung von Mineralen. Ab etwa 16 Kilometern Tiefe und ca. 300° Celsius aufwärts.
Steigen Druck und Temperatur noch weiter an, nimmt die Korngröße von Mineralen wieder ab, bis nur noch eine flache feinfasrige Gesteinsmasse übrig beleibt. Minerale wie Quarz, Muskovit, Pyroxen und Biotit, neigen dabei eher zum Zerfließen. Das ist in dem Mylonit von Calau, Foto 7 oben, sehr gut zu sehen. Wie der Ultramylonit von der Insel Rügen auf Foto 9 zeigt, kann so eine Veränderung schon auf kleinem Raum erfolgen.
Minerale haben prinzipiell eine unterschiedliche Widerstandskraft gegenüber der Verwitterung. In der Folge ist an der Oberfläche des Ultramylonits von Ponnsdorf (Foto 1 ganz oben) ein auffälliges schönes Relief-Muster entstanden.
Je nach Änderung der Richtungen von Scherbewegungen, kann diese Matrix noch zusätzlich verfaltet werden oder anfangen zu fließen. Letzteres ist bei dem Fundstück aus der Nähe von Ponnsdorf /Niederlausitz der Fall.
 |
| Foto 10: Detailaufnahme des Ultramylonits von Ponnsdorf /Niederlausitz |
Jegliche makroskopische Kristallstruktur ist verschwunden. Hier ist Quarz gemeinsam mit den übrigen Mineralen zu wellenförmigen asymmetrischen Falten verformt. Dass heißt, die entstandenen Falten sind zusätzlich verkrümmt. Die Folge: Ein kompliziertes Faltensystem, auch als Vorhangfalten bezeichnet.
Aufgrund der enormen tektonischen Kräfte, hat ein Zerfließen der Minerale eingesetzt. Es ist ein Ultramylonit entstanden.
 |
| Foto 11: Detailaufnahme des Ultramylonit von Ponnsdorf/Niederlausitz (Elbe-Elster). Seitenaufnahme mit frischer Bruch und extremer Beanspruchung der Faltenzüge. Verlust der makroskopischen Kristallstrukturen aller Minerale. |
Da die Eigenschaften der einzelnen Minerale gut bekannt sind, lässt sich aus dem Grad ihrer Veränderung auf die Druck- und Temperaturverhältnisse sowie auf die Tiefe der Prozesse in solchen duktilen Scherzonen schließen. Wobei wir hier über Tiefen zwischen 16 bis ca. 40 Kilometern sprechen. Bei unserem Ultramylonit von Ponnsdorf /Niederlausitz dürften Entstehungstiefen zwischen 30 und 40 Kilometern anzunehmen sein. Damit liefern sie wichtige Anhaltspunkte bei der Beurteilung der Abläufe in großen Tiefen der Erdkruste. In günstigen Fällen lässt sich so die Bewegungsrichtung der tektonischen Platten ableiten. Bei den eiszeitlichen Geschieben, mit denen wir es hier zu tun haben, leider nicht mehr. Sie sind von ihren anstehenden Gesteinskörper abgetrennt. Damit ist die Information über die Lage des Gesteinskörpers verloren gegangen.
Wie sind Mylonite im Verhältnis zu anderen tektonischen Verformungsgesteinen einzuordnen?
Das veranschaulicht am Besten eine Tabelle. Denn es gibt weitere Gruppen wichtiger Verformungsgesteine in Störungszonen. Kataklasite sind eines davon. Sie unterscheiden sich wesentlich von Myloniten. Denn sie zerbrechen bei Scherbewegungen Tektonischer Platten, was oft heftige Erdbeben zur Folge hat. Diese Gesteine (Brekzien verschiedener Korngrößen) sind als Eiszeitliches Geschiebe immer wieder zu finden.
 |
| Foto 12: Brekzie im Straßenpflaster auf dem Marktplatz der Stadt Sonnewalde. |
Von den weiteren drei Verformungsgesteinen in Scherzonen soll Migmatit nicht unerwähnt bleiben. Mehr dazu am Ende der Tabelle.
Kleine Übersicht über Metamorphite mit thermischen - mechanischen Verformungsgefügen
|
Gegenüberstellung der Festgesteine mit
Verformungsgefügen (vereinfacht)
|
|
Druck
|
Kataklasite
|
Mylonite
|
Temperatur
|
|
Protokataklasit
stark
zerbrochenes Gestein mit richtungslosem noch teilweisen groben
Bruchstücken, mit bloßem Auge noch gut erkennbar,
Tektonische
Brekzien, Gangbrüche aufgefüllt mit Bruchmaterial, oft
verkittet, Drusenbildungen, bspw. Gangquarzite
Räumliche Strukturen vollständig
erhalten.
|
Protomylonit
Kristalle
mit auffälligem Augengefüge, umfließende Strukturen um größere
Kristalle,
einzelne Minerale mit Brüchen, deren
Zwischenräume mit feinstem Mineralgemenge aufgefüllt sind,
Tendenz weicherer Mineralien zur Zweidimensionalität,
zur Abplattung und Fließen,
im Längsbruch
Gammelfleisch-Optik größerer Minerale,
|
|
|
Kataklasit
Sprödes
richtungsloses Gefüge,
Bruchbrekzien,
mittlere bis feine
Zertrümmerung, zermahlen,
bis hin zum
Gesteinsmehl,
in
der Regel verkittetes Gefüge,
richtungslos,
Räumliches
Gefüge bleibt weitgehend erhalten.
|
(Meso)-Mylonit
Deutliche
fließende Verformungsgefüge, Schlierenbildung,
Laminierung,
Kornverkleinerung der Minerale, dynamische
Umkristallisation in Druckrichtung →
Versetzungskriechen
Deutliche zweidimensionale
Verformung der Minerale.
|

|

|
Ultrakataklasit
Zertrümmerung bis in den
mikroskopischen Bereich,
Zerstörung selbst der
Mineralstrukturen,
kataklastisches Fließen der zerstörten
Gesteins- oder Mineralmasse (analog Pulverfließen), teilweise
mechanische Rekristallisation von Mineralen
Folge:
Schlierenbildungen, Schieferung,
mechanisch-dynamische
Neubildung einzelner Minerale,
|
Ultramylonit
flächiges, fasriges, dichtes,
laminiertes Gefüge, kleinfaltig, manchmal schieferartig, sehr
hart,
vollständiger Verlust bisheriger
Mineralstrukturen, sichtbar plastisches Verhalten der Minerale,
deutliches Versetzungskriechen,
thermisch-dynamische
Neukristallisation einzelner Minerale mit hoher
Kristallbindungsenergie, Kristallumwandlung, bspw. Feldspäte zu
Glimmern etc.
|

|
|

|
|
|
Bei Temperaturen von 650° bis 1 000°
Celsius setzen Aufschmelzprozesse ein.
Migmatite
entstehen.
Meist
feinkörnige dynamische Gefüge, sehr dicht, optisch oft
auffällig,
deutliche Schlierenbildungen, dünne, flache,
mäandernde Bänder und langgestreckte Linsen mit dunklen
Säumen.
Neubildung und Umkristallisation von Mineralen
unterschiedlicher Intensität.
Separation von Mineralen
aufgrund unterschiedlichem Schmelzpunkt setzt ein, Folge:
Bänderbildung.
Entwicklung entlang tektonischer
Brüche als schmale Bänder. Können mit Ultramyloniten oder
Ultrakataklasiten
vergesellschaftet sein.
Als
Eiszeitliches
Geschiebe häufig anzutreffen.
Hinweis: Migmatite können auch durch andere Aufschmelzprozesse entstehen. Beispielsweise an den Wurzeln von Gebirgen und den Rändern von Magmakörpern in der Erdkruste.
|
|
Tabelle: Metamorphite mit thermischen - mechanischen Verformungsgefügen.
 |
| Foto 13: Gneis-Migmatit mit Granat im Straßenpflaster der ehem. Brikettfabrik Louise. |
Nur der Vollständigkeit halber genannt, soll auf eine weitere Form der tektonischen Verformungsgesteine, Kakirit, hier nicht eingegangen werden. Es besteht primär aus Lockergesteinen.
Siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Kakirit
Eine Sonderform der Verformungsgesteine sind Pseudotachylite. Sie entstehen als Aufschmelzprodukte durch Reibungswärme bei sehr starken Erdbeben. Mehr dazu hier: Was sind Pseudotachylite?
Doch woher kommen unsere Mylonite?
Die Herkunft dürfte Schweden sein. In den über 3 Milliarden Jahren geologischer Entwicklung Skandinaviens, war genügend Zeit für eine ganze Reihe von Gebirgsbildungsprozessen mit Subduktionszonen und tektonischen Seitenverschiebungen. Also auch Zeit und genug Dynamik um Gesteine aus großen Tiefen wieder an das Tageslicht zu befördern und den Eiszeiten zum Abtransport zur Verfügung zu stellen. Eine der Saale-Eiszeiten hat offenbar diese Gelegenheit dazu genutzt und beim abtauen in der Nähe von Ponnsdorf und Kemmen Grundmoränen zurück gelassen. Verwitterung und freundliche Frauen der Kartoffelerntemaschine, haben diese kleinen geologischen Schätze wieder zu Tage gefördert.
Auch unsere drei anderen Fundstücke von Kemmen, Calau und der Insel Rügen, dürften aus Schweden kommen. Im Südosten Schwedens besteht ein großes Granitmassiv, dessen Gesteine in einer umfangreichen Scherzone mehreren Mylonitisierungen ausgesetzt waren. Das ganze geschah vor etwa 1,8 Milliarden Jahren.
Auch der insgesamt helle Habitus und die typische Zusammensetzung aus Kalifeldspat, Quarz, Plagioklas Biotit und Muskovit, deuten auf Granite und dessen Verwandte als Ursprungsgesteine unserer Niederlausitzer Fundstücke hin.
In Westschweden existiert sogar eine ca. 30 Kilometer breite und über 100 Kilometer lange Zone aus Myloniten. Ergebnis einer langandauernden Verschiebung Tektonischer Platten vor etwa 1 Milliarde Jahren.
Der Südosten Schwedens ist wiederholt Ausgangspunkt für die großen Eisströme verschiedener Eiszeiten gewesen. Grund genug zu der Annahme das diese Region Herkunftsgebiet unserer Niederlausitzer Mylonite ist.
Entgegen der Annahme des Geologen Julius Hesemann in seinem Buch über „Kristalline eiszeitliche Geschiebe der Nordischen Vereisung“ aus dem Jahr 1975, sind Mylonite als Leitgeschiebe nicht so gut geeignet. Denn sie treten neben dem Loftahammar-Gebiet auch in Dalsland (Westschweden) und einigen anderen kleinen Fundstellen Schwedens und Südnorwegens auf.
Wer in Myloniten Raritäten wittert, ans Sammeln und verkaufen denkt, sollte wissen, Schön können diese Gesteine sein, selten sind nicht. Lohnt also nicht. Trotzdem haben sie einen Wert, einen wissenschaftlichen. Und sind ein wichtiges Stück der Geologie unserer Niederlausitzer Heimatgeschichte.
Was bleibt also? Einige interessante Niederlausitzer Fundstücke. Besucher aus einer extrem fernen Vergangenheit und sehr großer Tiefe unseres Planeten, die ihren Weg ins Museum finden und damit der Allgemeinheit zugänglich sein werden.